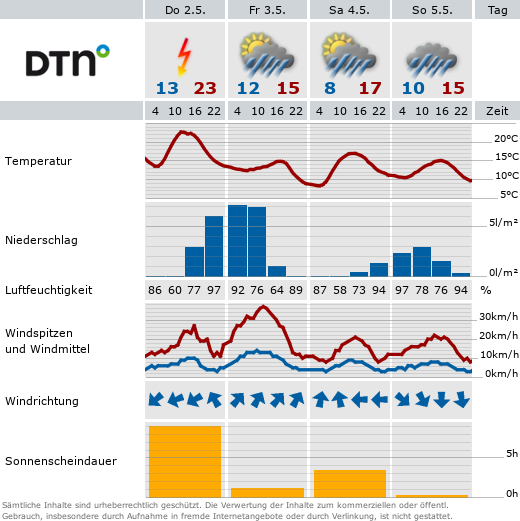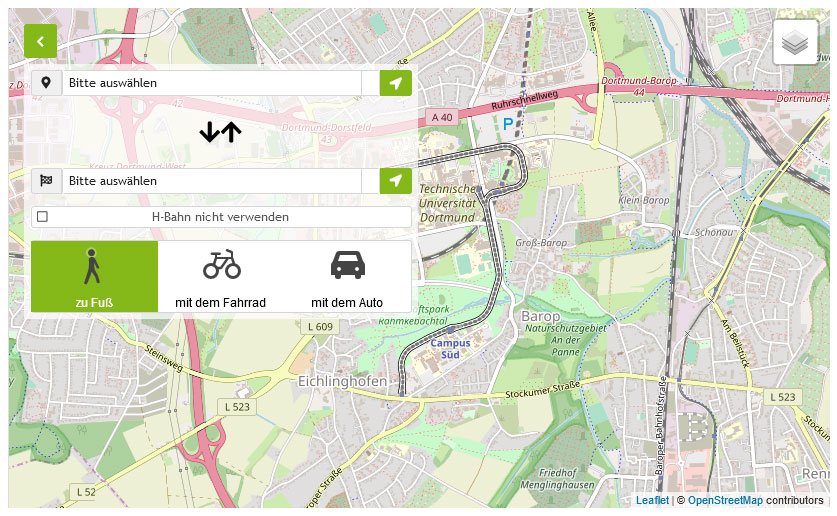Ein Überblick über den wissenschaftlichen Diskurs der letzten 50 Jahre
Die Debatte um geschlechtergerechte Sprache wird in deutschen Mainstream-Medien mit Schlagworten wie „Gender Gaga“ meist als jung, radikal und unnötig deklariert. Dabei wird der wissenschaftliche Diskurs um geschlechtergerechte Sprache in Deutschland bereits seit 50 Jahren geführt. Und auch im alltäglichen Sprachgebrauch wird deutlich: In vielen institutionellen und wissenschaftlichen Kontexten wird das generische Maskulinum zunehmend durch inklusive Formen ersetzt. Schon seit Jahren sprechen wir von Studierenden und nicht Studenten, von Schülerinnen und Schülern oder von Mitarbeiter*innen. Dies geht nicht zuletzt auf das Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG) zurück, das seit 1999 in Kraft ist. Das LGG reguliert die Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst. So müssen beispielsweise in offiziellen Anschreiben und Ansprachen neutrale Formulierungen oder gendersensible Zusätze gefunden und genutzt werden, sodass explizit Frauen und Männer angesprochen werden. Darüber hinaus sind Formulierungen erwünscht, die alle Geschlechtsidentitäten berücksichtigen und nicht auf das binäre System von “Mann” und “Frau” beschränkt bleiben. Zahlreiche Universitäten und Institutionen haben Leitfäden für inklusiver und diskriminierungskritischer Sprache entwickelt, um den alltäglichen Gebrauch zu erleichtern und zu normalisieren. Kritiker*innen der geschlechtergerechten Sprache wollen die deutsche Sprache konservieren und berufen sich darauf, dass im generischen Maskulinum Frauen mitgemeint seien. Forschung und internationaler wissenschaftlicher Diskurs der letzten 50 Jahre belegen hingegen, welche Diskriminierung sich hinter dem generischen Maskulinum verbirgt, wie geschlechtergerechte Sprache das Denken verändert und wie wir Menschen die Zukunft – auch sprachlich – inklusiv gestalten können.
Die im Text aufgeführten Studien und wissenschaftlichen Arbeiten sind aus Deutschland und u. a. auch aus den Vereinigten Staaten, Schweden und der Schweiz. Manche der englischsprachigen internationalen Arbeiten beziehen sich dennoch auf den deutschen Sprachraum.
Stand: Februar 2026
Ein halbes Jahrhundert
Eine der frühsten wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Sprache verfassten Sara und Daryl Bem bereits im Jahr 1973. In zwei Studien untersuchten sie die Auswirkungen von geschlechterexklusiven Stellenausschreibungen und bewiesen, dass sich Frauen vom generischen Maskulinum meist nicht angesprochen fühlten und sich dementsprechend nicht auf die jeweiligen Stellen bewerben wollten. Auch für Männer galt, dass sie sich nicht auf Stellen bewerben wollten, die sich vermeintlich an Frauen richteten (vgl. Bem & Bem 1973). Mit ihrem Befund blieben die beiden nicht allein: 1981 führte Anne Stericker eine vergleichbare Studie durch und kam zu Ergebnissen, die mit denen von Bem und Bem weitgehend übereinstimmten. Stericker kommt zu dem Schluss, dass vor allem Frauen sich von männlichen Titeln und Pronomen in Ausschreibungen weniger angesprochen fühlen, während ähnliche Effekte bei Männern von ihr nicht festgestellt wurden (vgl. Stericker 1981).
In den späten 1970ern nahm der Diskurs um eine faire Sprache besonders in feministischen Kreisen Fahrt auf und stellte Frauen wie Luise F. Pusch (Linguistikerin) in das Scheinwerferlicht. Ihr Einsatz gegen die sprachliche Diskriminierung der Frau kostete sie damals ihre akademische Karriere: Heute ist sie eine der Mitbegründerinnen der feministischen Linguistik und trägt zum Durchbruch der geschlechtergerechten Sprache bei (vgl. Olderissen 2019).
In den späten 1990ern befassten sich Irmen und Köhnke erstmals explizit mit dem psychologischen Effekt des generischen Maskulinums. Ihre Studie entwickeltes sich zu einer Basis, auf die bis heute viele Studien zu gendergerechter Sprache aufbauen (vgl. Irmen & Köhncke 1996). Diese Studien deckten auf, dass Frauen nicht immer mitgedacht werden, wenn von Ärzten, Studenten oder Erziehern die Rede ist. In verschiedenen Forschungsarbeiten wurden den Proband*innen alternative Formen des Genderns vorgestellt – Doppelnennung, Binnen-I und Schrägstrich werden dabei am häufigsten angeboten. Herausgestellt hat sich in allen Studien eines: Nur wenn Frauen explizit genannt werden, werden sie auch gedanklich miteinbezogen (vgl. Sczesny 2019; Heise 2003; Rothmund & Scheele 2004; Gygax et al. 2008). Besonders Sabine Sczesny (Sozialpsychologin) hat durch ihre zahlreichen Publikationen zu geschlechtergerechter Sprache hohes Ansehen im Feld der Geschlechterforschung erreicht. Ihre Beiträge zeigen, dass geschlechtergerechte Sprache ein essenzieller Teil zur Gleichberechtigung beiträgt und trotz zahlreicher Forschungsergebnisse, kaum Beachtung im öffentlichen Diskurs findet (vgl. Sczesny 2019).
Kinder & Sprache
Sprache und durch sie reproduzierte Stereotype haben großen Einfluss auf Kinder. Bereits im Grundschulalter teilen sie Berufe in „typisch männlich“ und „typisch weiblich“ ein. Besonders Mädchen verinnerlichen früh den Gedanken, dass sie nicht für „Männerberufe“ gemacht sind. Sie werden keine Ärzte, Feuerwehrmänner oder Astronauten. Umgekehrt ziehen Jungen nicht in Betracht, Erzieherin, Krankenschwester oder Grundschullehrerin zu werden. Durch Begrifflichkeit wie „Krankenschwester“ und „Feuerwehrmann“ findet eine Zuordnung des Geschlechtes bei Kindern statt (vgl. Vervecken & Hannover 2015; Liben et al. 2002; Phair 2021).
Um das Selbstbild junger Mädchen zu stärken braucht es eine Sprache, die sie nicht ausklammert. Geschlechtergerechte Sprache hilft Mädchen, sich selbst in männlich geprägten Berufsfeldern zu sehen. Nicht nur das, sie stärkt ihr Selbstbewusstsein, dass sie mindestens genauso kompetent wie Jungen in diesen Feldern sind und die gleiche Anerkennung verdienen. Diese Erkenntnisse werden von einer Studie aus der französischen Schweiz bestärkt, die nachweist, dass gendersensible Sprache hilft, veraltete und sexistische Stigmatisierungen bei Jugendlichen abzubauen (vgl. Vervecken et al. 2015).
Gendergerechtigkeit im Berufsleben
Studien belegen, dass Frauen sich bis heute nicht von männlichen Ausschreibungen angesprochen fühlen. Dieser Effekt ist auch in anderen Kontexten relevant: In einer Studie aus 2017 wurden Ausschreibungen von Programmen für Unternehmer*innen untersucht. Wird das generische Maskulinum angewandt, glauben Frauen trotz entsprechender Qualifikationen die Anforderungen der Ausschreibungen nicht erfüllen zu können. Dies führt dazu, dass sich weniger Frauen auf diese Ausschreibungen bewerben, auch wenn die Intention hinter den Programmen darin liegt, mehr Frauen anzuwerben (vgl. Hentschel et al. 2018). Zudem wurde untersucht inwiefern Frauen als weniger kompetent in Führungspositionen angesehen werden. Dabei stellte sich heraus, dass Führungspositionen ohne triftigen Grund vermehrt an Männer vergeben werden, wenn Frauen in Ausschreibungen nicht explizit erwähnt werden. Bei geschlechterinklusiven Stellenausschreibungen wurden bedeutend mehr Frauen als fähig angesehen, die Position ausfüllen zu können (vgl. Hovarth & Sczesny 2015). Geschlechtergerechte Sprache hat massiven Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung von Frauen. Damit ist sie ein wichtiger Schritt hin zu einer ausgewogenen Geschlechterbilanz in allen Berufsfeldern und auf allen Karrierestufen.
Verständlichkeit
Der wohl größte Kritikpunkt an geschlechtergerechter Sprache bezieht sich auf ihre (Un-) Verständlichkeit. Immer wieder heißt es, dass Texte die inklusive Sprachformen verwenden, an Lesbarkeit einbüßen. Anderen Kritiker*innen geht es um die Ästhetik der deutschen Sprache. Nach ihnen werden die Worte auf unschöne Weise zerrissen und Sonderzeichen sollten nicht innerhalb von Worten genutzt werden. Für die Sonderzeichen wie Gendergap oder Sternchen Nutzenden ist das visuelle Stolpern kein störender Zufall, sondern Intention: Das Sonderzeichen sticht heraus, lässt die Leser*innen kurz innehalten und führt so zum aktiven Mitdenken aller Geschlechter (vgl. JDAV 2018).
Ein bewusstes Stolpern ist nicht mit Unverständlichkeit gleichzusetzten. Seit 2013 wurden in verschiedenen Studien Texte auf ihre subjektive Verständlichkeit geprüft; Proband*innen wurden Texte mit generischem Maskulinum, Beidnennung und anderen Formen der gendersensiblen Sprache vorgestellt. Frauen empfanden die Texte in allen Studien durchweg gleich gut verständlich. Vereinzelte Männer stuften das generische Maskulinum als verständlicher ein (vgl. Rothmund & Christmann 2004; Steiger & Irmen 2007; Braun et al. 2007; Steiger-Loerbroks & von Stockhausen 2014; Pöschko & Prieler 2018). Als störend wurde besonders die Doppelnennung empfunden. In einer Studie von Braun (2007) wurden die Teilnehmer*innen nach dem Lesen zu den Texten befragt und es stellte sich heraus, dass es auch objektiv keine signifikanten Unterschiede in der Verständlichkeit gab. Geschlechtsneutrale Begriffe werden in den meisten Studien am bereitwilligsten angenommen (vgl. Weise 2007). Unabhängig davon, welche Altersgruppe befragt wurde, konnten keine Nachteile in Erinnerungsvermögen, Verständlichkeit und Lesbarkeit festgestellt werden.
Verbreitung & Nutzen geschlechtergerechter Sprache
Wer benutzt geschlechtergerechte Sprache? Wie verbreitet sie sich? Und geht ihr Nutzen über die Sichtbarkeit von Frauen hinaus? Dass der Diskurs um eine faire Sprache älter ist als die Berichterstattung vieler Mainstream-Medien annehmen lässt, wurde bereits erwähnt. Dennoch ist die Debatte in den letzten zehn Jahren besonders präsent geworden. Das liegt daran, dass geschlechtergerechte Sprache in allen Bereichen unseres Alltags auftaucht und in vielen Bereichen bereits zur Normalität geworden ist. Begriffe wie Studierende, Beschäftigte, Pflegekraft und Kanzlerin sind fester Bestandteil unseres Wortschatzes und werden nicht mehr hinterfragt.
Massenmedien haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss, nicht nur auf die Verbreitung gendergerechter Sprache, sondern auch auf das Verhalten ihrer Konsument*innen. Im Rahmen einer Studie legten Hansen, Littwitz und Szczesny (2016) Teilnehmerinnen kurze Beiträge vor, in welchen entweder von „Helden“ oder „Helden und Heldinnen“ die Rede war. Der geschlechterinklusive Beitrag führte nicht nur zu einer verstärkten Visibilität von Frauen, sondern regte auch bei den Teilnehmer*innen die Nutzung geschlechtergerechter Sprache an (vgl. Hansen et al. 2016).
Nicht jede*r übernimmt eine geschlechtergerechter Sprache. Gendern ist politisch - das gilt sowohl für das Verwenden inklusiver Formen als auch für das Verwenden des generischen Maskulinums. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Intention hinter der Nutzung männlicher Sprache von systemischem Sexismus beeinflusst ist und die Nutzung geschlechtergerechter Sprache eine bewusste Entscheidung darstellt, sich gegen dieses sexistische System zu wehren (vgl. Sczesny et al. 2015). Die einfachste und wohl auch eine der effektivsten Methoden, um einen Menschen von geschlechtergerechter Sprache zu überzeugen, ist ein simples Darlegen der Argumente für eine geschlechtergerechte Sprache und die konsequente Nutzung geschlechterinklusiver Sprache. Durch ein unkommentiertes Vorleben lässt sich die Sorge um eine Verkomplizierung des Sprechens und Schreibens am ehesten auflösen. Im Gegensatz dazu scheinen Argumente von Kritiker*innen gegen eine geschlechtergerechte Sprache keinen nennenswerten Einfluss auf die Rezipient*innen und ihren Sprachgebrauch zu haben (vgl. Koeser & Sczesny 2014). Wie tief Geschlecht und die damit verbundenen Stigmatisierungen in den Köpfen verankert sind, zeigt sich in einer umfangreichen Studie von Gygax et al. (2008). Darin belegt der Psycholinguist, dass Doppelnennungen und inklusive Sprachformen die Grenzen stereotyper Berufsbezeichnungen nicht allein überwinden können. Somit ist klar, dass geschlechtergerechte Sprache nur als ein Baustein auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit gesehen werden kann. Einen Überblick über die Nutzung, Verbreitung und die Effekte gendergerechter Sprache bietet die Arbeit „Can Gender-Fair Language Reduce Gender Stereotyping and Discrimination?“ von Sczesny et al. (2016).
Sternchen, Gap und Kolon – inklusive Sprache jenseits der Binarität
Der Diskurs um gendergerechte Sprache wird seit den 1970er Jahren geführt, doch die Inklusion nicht binärer Menschen wurde erst ab den 2010ern zu einem breit diskutierten Thema. Dabei forderte der_die Sozialphilosoph_in Stefan Kitty Hermann bereits 2003 den Gendergap, um all jene zu inkludieren, die in der deutschen Sprache seit jeher unsichtbar sind (vgl. Hermann 2003). Das Binnen-I, das wesentlich zur Verbreitung gendergerechter Sprache beitrug, wird mittlerweile zunehmend durch Gendergap_, Genderkolon: und Gendersternchen* ersetzt. Letzteres scheint sich seit 2015 zunehmend durchzusetzen.
Diese Formen des inklusiven Genderns sind bislang trotz ihrer weiten Verbreitung kaum Gegenstand wissenschaftlicher Studien. Seit 2017 gibt es in Deutschland neben männlich und weiblich den Geschlechtseintrag divers. Er wurde für intergeschlechtliche Menschen geschaffen, die sich nicht im binären Geschlechtersystem wiederfinden bzw. verorten. Auch diese Entwicklungen befördern die weitere Auseinandersetzung mit diskriminierungskritischer Sprache und der Sichtbarkeit aller Geschlechter.
Gendern heute und in Zukunft
Um zu sehen, wie die Zukunft für eine genderinklusive Sprache in Deutschland aussehen könnte, hilft ein Blick nach Schweden. Die schwedische Sprache war bis vor wenigen Jahren in Bezug auf Gender ähnlich aufgebaut wie die deutsche: binär getrennt in männlich und weiblich. In 2012 hat die schwedische Regierung das alte System aufgebrochen und das geschlechtsneutrale Pronomen „hen“ eingeführt, was eine Alternative zu sie (hon) und er (han) bietet. Wurde hen 2012 noch negativ von der Bevölkerung aufgenommen, hat sich in nur vier Jahren die Attitüde gegenüber dem Neopronomen gewandelt. Hen wird zwar nur allmählich von Schwed*innen in ihren alltäglichen Sprachgebrauch aufgenommen, aber die dritte Option wird in Schweden zunehmend akzeptiert (vgl. Gustafsson Sendén et al. 2015). Mit den Dimensionen der Vorbehalte gegenüber dem geschlechtsneutralen Pronomen hen befasste sich eine Studie, deren Ziel die Forschung nach den Ursachen für Kritik und Verunsicherung der Kritiker*innen ist. Die Ergebnisse sind in einem Artikel zusammengefasst, der zahlreiche Argument für eine geschlechtergerechte Sprache enthält und auch Vorbehalte und Sorgen der Kritiker*innen entkräftet (vgl. Vergoossen et al. 2020).
Der Diskurs um geschlechtergerechte Sprache entwickelt sich rasant weiter und es ist nicht immer einfach, auf dem neusten Stand zu bleiben. Wichtig ist weiter zu forschen, Diskriminierungen aufzudecken und positive Veränderungen festzuhalten. Jede*r kann sich dafür einsetzten, dass geschlechtergerechte Sprache alltäglich wird, indem sie*er sie selbst in Wort und Schrift anwendet. Aktuelle Entwicklungen zeigen sich in Diskursen der Massenmedien und in Quellen, die sich gezielt und fundiert mit der Debatte auseinandersetzen. Ein Beispiel hierfür ist der „blog interdisziplinäre Geschlechterforschung“ des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW.
Quellen
Bem, Sandra & Daryl Bem (1973): „Does Sex‐biased Job Advertising “Aid and Abet” Sex Discrimination?“, Journal of Applied Social Psychology, Band 3, Heft 1, S. 6-18.
Braun, Frederike; Oelkers, Susanne; Rogalski, Karin; Bosak, Janine & Sczesny, Sabine (2007): „‘Aus Gründen der Verständlichkeit ...‘: Der Einfluss generisch maskuliner und alternativer Personenbezeichnungen auf die kognitive Verarbeitung von Texten“, Psychologische Rundschau, Band 58, Heft 3, S. 183-189.
Gustafsson Sendén, Marie; Bäck, Emma A. & Lindqvist, Anna (2015): „Introducing a gender-neutral pronoun in a natural gender language: the influence of time on attitudes and behavior”, Frontiers in Psychology, Band 6, Artikel 893.
Gygax, Pascal; Gabriel, Ute; Sarrasin, Oriane; Oakhill, Jane & Garnham, Alan (2008): „Generically intended, but specifically interpreted: When beauticians, musicians and mechanics are all men”, Language and Cognitive Processes, Band 23, Heft 3, S. 464-485.
Hansen, Karolina; Littwitz, Cindy & Sczesny, Sabine (2016).: „The Social Perception of Heroes and Murderers: Effects of Gender-Inclusive Language in Media Reports”, Frontiers in Psychology, Band 7, Artikel 369.DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00369
Heise, Elke (2003): „Auch einfühlsame Studenten sind Männer: Das generische Maskulinum und die mentale Repräsentation von Personen“, Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis, S. 285–291.
Hentschel, Tanja; Horvath, Lisa Kristina; Peus, Claudia & Sczesny, Sabine (2018): „Kick-starting female careers: Attracting women to entrepreneurship programs“, Journal of Personnel Psychology, Band 17, Heft 4, S. 193-203.
Hermann, Steffen Kitty (2003): „Performing the Gap - Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung“, arranca!, Heft 28.
Hovarth, Lisa Kristina & Sczezny, Sabine (2015): „Reducing women’s lack of fit with leadership positions? Effects of the wording of job advertisements”.
Irmen, Lisa; Köhncke, Astrid (1996): „Zur Psychologie des ‚generischen‘ Maskulinums“, Sprache & Kognition: Zeitschrift für Sprach- und Kognitionspsychologie und ihre Grenzgebiete, Band 15, Heft 3, S. 152-166.
Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) (2018): „Geschlechtergerechte Sprache: Gendersensibel schreiben und formulieren in JDAV-Publikationen“.
Koeser, Sara & Sczezny, Sabine (2014): „Promoting Gender-Fair Language: The Impact of Arguments on Language Use, Attitudes, and Cognitions”, Journal of Language and Social Psychology, Band 33, Heft 5, S. 548-560.
- Liben, Lynn S.; Bigler, Rebecca S. & Krogh, Holleen R. (2002): „Language at work: children's gendered interpretations of occupational titles“, Children Development, Band 73, Heft 3, S. 810-828. DOI: 10.1111/1467-8624.00440.
- Olderissen, C. (2019): Luise F. Pusch – Die feministische Lingusitik hat ihr Leben bestimmt. Verfügbar unter: Genderleicht & Bildermächtig vom Journalistinnenbund e.V.
Phair, Rowena (2021): Gender norms are clearly evident at five years of age.
Pöschko, Heidemarie & Prieler, Veronika (2018): „Zur Verständlichkeit und Lesbarkeit von geschlechtergerecht formulierten Schulbuchtexten“, Zeitschrift für Bildungsforschung, Band 8, Heft 1, S. 5-18.
Rothmund, Jutta & Christmann, Ursula (2002): „Auf der Suche nach einem geschlechtergerechten Sprachgebrauch: Führt die Ersetzung des 'generischen Maskulinums' zu einer Beeinträchtigung von Textqualitäten?“, Muttersprache, Band 112, Heft 2, S. 115-136.
Rothmund, Jutta & Scheele, Brigitte (2004): „Personenbezeichnungsmodelle auf dem Prüfstand“, Zeitschrift für Psychologie, Band 212, Heft 1, S. 40-54.
Sczesny, Sabine (2019): Sprache // Wieso muss das sein?! Zum Nutzen geschlechtergerechter Sprache. DOI: 10.17185/gender/20191015
Sczesny, Sabine; Formanowicz, Magda & Moser, Franziska (2016): „Can Gender-Fair Language Reduce Gender Stereotyping and Discrimination?”, Frontiers in Psychology, Band 7, Artikel 25.
Sczezny, Sabine; Moser, Franziska & Woord, Wendy (2015): „Beyond Sexist Beliefs: How Do People Decide to Use Gender-Inclusive Language?”, Personality and Social Psychology Bulletin, Band 41, Heft 7, S. 943-954.
Steiger, Vera & Irmen, Lisa (2007): „Zur Akzeptanz und psychologischen Wirkung generisch maskuliner Personenbezeichnungen und deren Alternativen in juristischen Texten“, Psychologische Rundschau, Band 58, Heft 3, S. 190-200.
Steiger-Loerbroks, Vera & von Stockhausen, Lisa (2014): „Mental representations of gender-fair nouns in German legal language: An eye-movement and questionnaire-based study”, Linguistische Berichte, Heft 237.
Stericker, Anne (1981): „Does this "He or She" Business Really Make a Difference? The Effect of Masculine Pronouns as Generics on Job Attitudes“, Sex Roles, Band 7, Springer, S. 637-641.
Vergoossen, Petronella Hellen; Renström, Emma Aurora; Lindqvist, Anna & Gustafsson Sendén, Marie (2020): „Four Dimensions of Criticism Against Gender-Fair Language”, Sex Roles, Heft 83, S. 328-337.
Vervecken, Dires; Gygax, Pascal M.; Gabriel, Ute; Guillod, Matthias & Hannover, Bettina (2015): „Warm-hearted businessmen, competitive wives? Effects of gender-fair language on adolescents’ perceptions of occupations”, Frontiers in Psychology, Band 6, Artikel 1437.
Vervecken, Dries & Hannover, Bettina (2015): „Yes I can! Effects of gender fair job descriptions on children’s perceptions of job status, job difficulty, and vocational self-efficacy”, Social Psychology, Band 46, Heft 2, S. 76-92.
Weise, Julia (2007): „Sprache und Geschlecht: Eine empirische Untersuchung zur ‚geschlechtergerechten Sprache‘“, Studentische Arbeitspapiere zu Sprache und Interaktion, Heft 13.