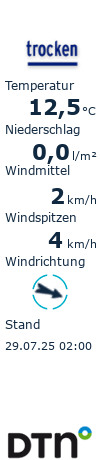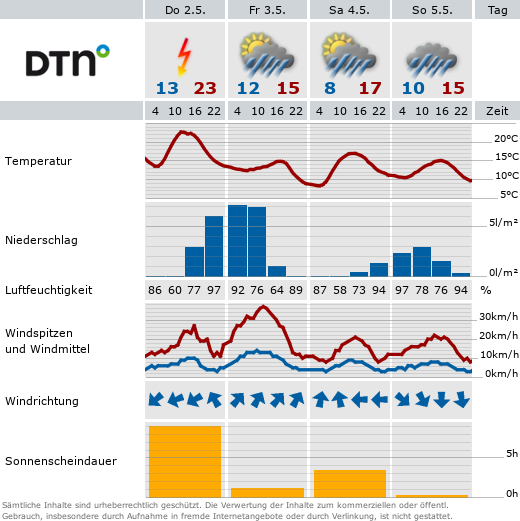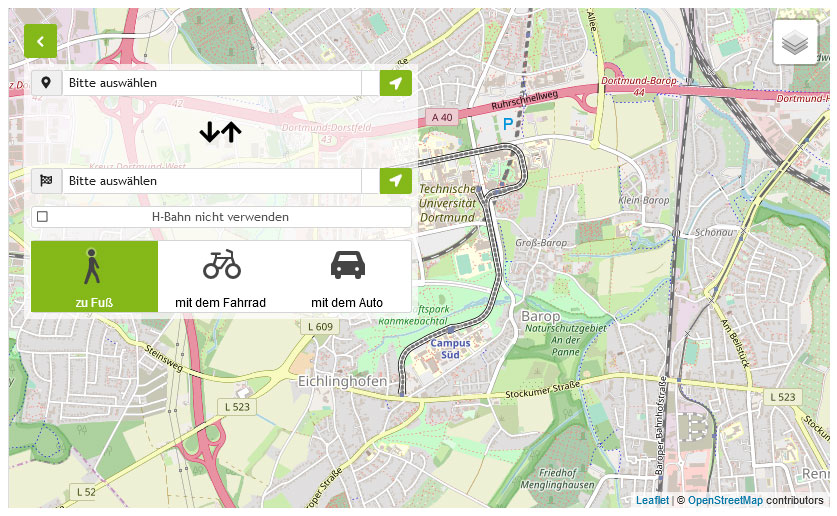Jahrestag des Grundgesetzes
Die Entstehung des Grundgesetzes
Als Startpunkt einer Reihe von Ereignissen, die in der Erarbeitung des Grundgesetzes mündeten, lässt sich die „Sechsmächte-Konferenz“ im Juni 1948 in London feststellen. Sechs Mächte – USA, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg – arbeiteten bei der Konferenz die „Londoner Empfehlungen“ (Görtemaker 2007) für die Militärgouverneure der alliierten Mächte in Westdeutschland aus.Basierend auf diesen Empfehlungen gaben die Militärgouverneure den Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Bundesländer den Auftrag, eine „verfassungsgebende Versammlung“ (Görtemaker 2007) einzuberufen, damit die Gründung eines gemeinsamen Staates eingeleitet werden konnte. Noch im selben Jahr fand ein „vorbereitender Verfassungskonvent“ (Görtemaker 2007) der elf Länder statt, auf dem „Richtlinien für das Grundgesetz eines ‚Bundes Deutscher Länder‘“ (Görtemaker 2007) erarbeitet wurden. Darauf basierend formulierte der eigens dafür einberufene Parlamentarische Rat im September 1948 den Entwurf für das Grundgesetz. Dieser Entwurf wurde im Mai 1949 angenommen und von den Besatzungsmächten genehmigt. Das somit beschlossene Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 unterzeichnet und verkündet. Am folgenden Tag trat es in Kraft, womit auch die Bundesrepublik Deutschland gegründet war.
Während man im Osten Deutschlands in der sowjetischen Besatzungszone seit 1947 auf einen gemeinsamen deutschen Staat gehofft und hingearbeitet hatte, trat als Reaktion auf die Gründung der BRD am 7. Oktober 1949 die „Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik“ in Kraft – ein Akt, der die offizielle Staatsgründung der DDR markiert (Görtemaker 2007). 1990 trat die Deutsche Demokratische Republik der Bundesrepublik Deutschland bei. Somit gilt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nunmehr auch für das Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Gleichberechtigung und Gleichstellung im Grundgesetz – Artikel 3
Die Originalfassung des Grundgesetzes von 1949 besteht aus einer Präambel und 146 Artikeln, die in elf Abschnitte gegliedert sind.
Anders als in älteren Verfassungen der deutschen Geschichte, wie die Reichsverfassung Bismarcks von 1871 oder die Weimarer Verfassung von 1919, sind beim Grundgesetz die „materiellen Grundrechte“ direkt an den Anfang gestellt (Feldkamp 2008). Sie machen Artikel 1 bis 19 aus und beinhalten sehr bekannte Formulierungen wie Artikel 1 Absatz 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Bundesministerium für Justiz 2025). Weitere Grundrechte sind beispielsweise das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung, körperliche Unversehrtheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und viele mehr. Für Hochschulen ist zudem Artikel 5 Absatz 3 wichtig: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“
Für die Gleichberechtigung und Gleichstellung ist Artikel 3 besonders interessant. Er beinhaltet die folgenden drei Absätze, wobei die kursiv markierten Sätze 1949 noch kein Teil des Gesetzestexts waren; sie wurden 1994 hinzugefügt (Weis 2024; Bundeszentrale für politische Bildung 2024):
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. (Bundeszentrale für politische Bildung 2016)
Die Formulierung von Artikel 3 Absatz 2 stellte erstmalig die vollständige Gleichberechtigung von Frauen und Männern als ein durch die Verfassung geschütztes Grundrecht sicher.
Artikel 3 in das Grundgesetz aufzunehmen war jedoch kein einfaches Unterfangen. Der Wortlaut wurde von Elisabeth Selbert - eine der vier weiblichen Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Rats, welche „Mütter des Grundgesetzes“ genannt werden - verfasst und gegen zunächst großen Widerstand verteidigt (Weis 2024). Ihre Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ wurde in gleich zwei Ausschüssen im November und Dezember 1948 abgelehnt. Noch im selben Monat und im Januar 1949 organisierte Elisabeth Selbert einen breit aufgestellten Protest, bei dem sie die Mitglieder verschiedener Organisationen dazu motivierte, Stellungnahmen an die Teilnehmer*innen des Parlamentarischen Rats zu senden. Daran beteiligten sich unter anderem das Frauensekretariat der SPD sowie religiöse, gewerkschaftliche oder berufsständische Frauenverbände. Selberts Kollegin im Parlamentarischen Rat und Mitstreiterin in Sachen Gleichstellungsgrundsatz Helene Weber nannte diese Protestaktion einen „Sturm aus den verschiedenen Gruppen“ (Weis 2024), von dem sich letztendlich alle Mitglieder des Parlamentarischen Rates überzeugen ließen: Am 18. Januar 1949 wurde der Antrag einstimmig angenommen, den Wortlaut wie von Selbert vorgeschlagen, ins Grundgesetz aufzunehmen (Weis 2024; BFSFJ 2024).
Viele zeitgenössische Gesetze spiegelten dieses Grundrecht allerdings noch nicht wider. So hatten zum Beispiel Männer noch bis 1957 das im Familienrecht feststehende „Letztentscheidungsrecht“ über ihre Ehefrauen (BFSFJ 2024). Dieses wurde durch das im Juli 1958 in Kraft getretene „Gleichberechtigungsgesetz“ (Bundesregierung 2024) ausgehebelt. Nun konnten Frauen eigenständig entscheiden, ob sie berufstätig sein möchten, ihren Führerschein machen oder ein Bankkonto eröffnen – zumindest, solange diese Dinge nicht mit ihren ‚Pflichten‘ im Haushalt und bei der Kindererziehung im Konflikt standen (Bundesregierung 2024). Veränderungen wie diese wurden durch den kurzen, aber prägnanten Satz in Artikel 3 Absatz 2 möglich gemacht.
Gleichberechtigung und Gleichstellung sind andauernde Prozesse – auch in Gesetzestexten
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist also schon seit über 75 Jahren im deutschen Grundgesetz verankert. Die tatsächliche Umsetzung dieses Verfassungsgrundsatzes ist allerdings nach wie vor unzureichend erfolgt. So sind zum Beispiel Frieda Nadig – die dritte der vier Mütter des Grundgesetzes - und Helene Webers Bemühungen zu Lohngleichheit auch in den 2020er Jahren noch aktuell: Im Jahr 2024 existierte in Deutschland ein Gender Pay Gap von 16 % - das heißt, Frauen erhielten in diesem Jahr durchschnittlich 16 % weniger Gehalt als Männer (Statistisches Bundesamt 2025).
Das rechtliche Verständnis von Gleichberechtigung entwickelt sich konstant weiter, weshalb auch die zugehörigen Gesetzestexte stetig angeglichen oder überarbeitet werden müssen. 1977 wurde beispielsweise das Ehe- und Familienrecht reformiert und 1980 ein Gesetz zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz verabschiedet (Dörr 2024).
1994 wurde ein sehr bekannter und wichtiger Zusatz zum Grundgesetz hinzugefügt: Die Verfassungskommission beschloss, Artikel 3 Absatz 2 durch den oben bereits erwähnten Satz „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“ zu ergänzen. Damit bekannte sich der Bundestag dazu, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein noch immer nicht erreichtes, wichtiges Ziel ist und es in der Verantwortung der Regierungsorganisationen liegt, diese voranzutreiben (BFSFJ 2024). Ebenso wurde 1994 Absatz 3 des Artikels ein Satz hinzugefügt, der die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen verurteilt (Bundeszentrale für politische Bildung 2024).
Ein Vermerk dazu, dass keine Person aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder Sexualität diskriminiert werden darf, fehlt im Grundgesetz. Organisationen, die sich für einen solchen Zusatz einsetzen, begründen seine Notwendigkeit vor allem damit, dass queere Menschen ebenfalls eine „Opfergruppe des Nationalsozialismus“ (Verband Queere Vielfalt 2024) darstellten und als solche verfassungsverankerten Schutz verdienen. Vor allem queere Organisationen und Verbände vermissen, dass die Diskriminierung von Menschen, die Teil der LSBTTIAQ+ Community sind, nicht im Grundgesetz erwähnt wird, und setzen sich weiter unermüdlich für diese Ergänzung ein.
Die „Mütter des Grundgesetzes“
Die vier Frauen, die 1949 Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Rates waren, werden, wie oben erwähnt, als „Mütter des Grundgesetzes“ bezeichnet: Elisabeth Selbert, Friederike (Frieda) Nadig, Helene Weber und Helene Wessel.
Elisabeth Selbert war Juristin, Mitglied der SPD und kämpfte in den Diskussionen des Parlamentarischen Rates unter anderem für ein unabhängiges Rechtswesen und Richteramt. Aus ihrem Bestreben entstand das heutige Bundesverfassungsgericht. Besonders bekannt ist sie aber für ihre zentrale Rolle in den Verhandlungen zu dem prägnanten Wortlaut des Gleichheitsgrundsatzes im Artikel 3 Absatz 2.
Frieda Nadig war Mitglied der SPD und von ihrer Arbeit im Parlamentarischen Rat im Jahr 1949 bis 1961 Abgeordnete des deutschen Bundestags. Sie setzte sich in den Verhandlungen um das Grundgesetz besonders für die Themen Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern sowie die Rechte von unehelichen Kindern ein (BFSFJ 2024).
Helene Weber von der CDU war eine von vier Mitgliedern des Parlamentarischen Rates, die auch bereits bei der Nationalversammlung zur Verfassung der Weimarer Republik anwesend waren. Sie war von 1949 bis 1962 Abgeordnete im Bundestag und vertrat diesen auch in Gremien des europäischen Auslands. Sie kämpfte insbesondere für Elternrechte und den Schutz von Ehe und Familie. Wie auch Frieda Nadig setzte sie sich zudem für die Lohngleichheit ein (BFSFJ 2024).
Helene Wessel wurde in Dortmund geboren und gehörte bis 1951 der Zentrumspartei an. In diesem Jahr gründete sie die „Notgemeinschaft zur Rettung des Friedens in Europa“, aus der später die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP) entstand. Die GVP wurde jedoch 1957 aufgelöst, woraufhin Wessel in die SPD eintrat. Sie war von 1949 bis 1951 und von 1957 bis 1969 Mitglied im Bundestag. Ähnlich wie Weber setzte auch sie sich explizit für den Schutz von Familien und Eltern ein. Wessel war eine von zwölf Abgeordneten, die gegen den Entwurf des Grundgesetzes von 1949 stimmten. Ihrer Meinung nach fehlte es dem Entwurf an einigen Grundrechten und sie plädierte für mehr Volksentscheide, um die BRD demokratischer zu gestalten. Sie unterzeichnete den Entwurf letztendlich aber doch (BFSFJ 2024).
Stand: Mai 2025
Quellen
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2024): Mütter des Grundgesetzes. Abgerufen am 07.05.2025.
- Bundesministerium für Justiz (2025): Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 94) geändert worden ist. Abgerufen am 07.05.2025.
- Bundesregierung (2024): Der Gleichstellungsauftrag des Grundgesetzes. Abgerufen am 07.05.2025.
- Bundeszentrale für politische Bildung (2016): Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Artikel 1–19. Abgerufen am 07.05.2025.
- Bundeszentrale für politische Bildung (2024): Vor dreißig Jahren: Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Abgerufen am 14.05.2025.
- Dörr, Beate (2024): Ein Glücksfall für die Demokratie. Die Vier Mütter des Grundgesetzes. Abgerufen am 14.05.2025.
- Görtemaker, Manfred (2007): Von den Londoner Empfehlungen zum Grundgesetz Ein kurzer Überblick zur Entstehung der Bundesrepublik Deutschland. Abgerufen am 07.05.2025.
- Feldkamp, Michael F. (2008): Zentrale Inhalte des Grundgesetzes. Abgerufen am 07.05.2025.
- Statistisches Bundesamt (2025): Gender Pay Gap 2023: Deutschland bleibt eines der EU-Schlusslichter. Abgerufen am 07.05.2025.
- Verband Queere Vielfalt (2024): 75 Jahre Grundgesetz ohne expliziten LSBTIQ*-Schutz. LSVD fordert dringend Ergänzung von Artikel 3 Abs. 3 GG. Abgerufen am 07.05.2025.
- Weis, Natalie (2024): Vor 75 Jahren: Gleichberechtigung im Grundgesetz. Abgerufen am 07.05.2025.